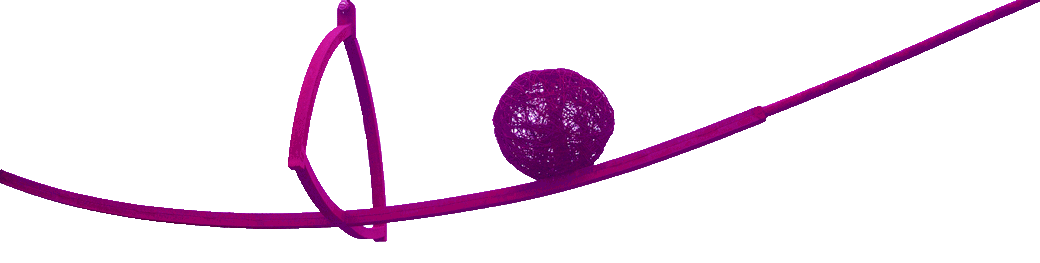Perspektiven einer feministischen Ökonomie.
Das, was sich heute unter einem Begriff Feministische Ökonomie präsentiert, gibt es seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert. Auf der Jahreskonferenz 1992 der American Social Science Association (ASSA) versammelte sich eine kleine Schar von Hochschullehrerinnen im Fach Economics und probte den Aufstand gegen die exklusive Männlichkeit ihrer Disziplin. Heraus kam die Gründung eines feministisch-ökonomischen Netzwerks mit dem Ziel, ein Fundament zu schaffen für eine eigenständige Frauensicht auf wirtschaftliches Handeln im Industriezeitalter und darüber hinaus.
Man nahm sich vor, einer Vielfalt von Ungereimtheiten nachzuspüren, denen sich Frauen im Wirtschaftsleben gegenübersehen. Den Gründerinnen war daran gelegen, von Anfang an Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und Alternativen zu einer Wirtschaftsweise zu entwickeln, von der Frauen und ihre Kinder an den Rand gedrängt werden.
Resonanz erhielt die neu gegründete International Association of Feminist Economics (IAFFE) damals vorrangig aus den USA, zumal die Teilhabe von Frauen an Forschung, Lehre und wirtschaftlicher Macht in anderen Ländern noch geringer war als in der Neuen Welt. Doch im Zeitalter des Übergangs von der Industriewirtschaft zur wissensbasierten Dienstleistungsökonomie wächst überall das Interesse, die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Frauen und Männern nicht nur durch die Brille von Theorien zu betrachten, die sich mit (globalen) Geld- und Güterströmen befassen.
Ein erstes, bereits 1993 erschienenes Buch trug den Titel Beyond Economic Man*. Es erhob den Vorwurf, das moderne Verständnis des Wirtschaftens sei geprägt von männlichen Erfahrungen und Interessen und vernachlässige die Notwendigkeit, auch anderen als materiellen Bedürfnissen Raum zu geben. Man erinnerte an die symbolische Bezugnahme der Fachdisziplin auf den Oikos des griechischen Altertums, die in den Begriffen economics und ecology zum Ausdruck kommt.
Im Sinne einer lebensdienlichen Ökonomie müsse sich wirtschaftliches Handeln am Wohlergehen der (Haus)Gemeinschaft orientieren, deren Ziel es sei, in gegenseitiger Unterstützung mit begrenzten Mitteln ein gutes Leben für alle zu schaffen. Demgegenüber begründe die Mainstream-Theorie ihre Argumentation mit dem Verweis auf den homo oeconomicus, der durch die Maximierung seines persönlichen Nutzens materiellen Reichtum schafft. Er versteht sich zwar als autonomes Individuum, als Ökonom/Haushaltsvorstand lässt er die Seinen jedoch großzügig teilhaben an den Erträgen seiner Umsicht und Schaffenskraft.
Gegenüber den etablierten Sichtweisen der Wirtschaftswissenschaften verlagert Feministische Ökonomie den Schwerpunkt wirtschaftlichen Handelns von Maximierung und Effizienz der Güterproduktion zu Kooperation auf der Basis von Gegenseitigkeit, zu Wohlergehen und Gerechtigkeit. Aus dieser Sicht erwächst eine Perspektive, die nicht nur zur Kritik an vorhandenen Positionen und Strukturen, sondern zu ganz neuen Fragestellungen Anlass gibt.
Der institutionalisierte Familienhaushalt fungiert bis heute als Grundbaustein des ökonomischen Theoriegebäudes. Von Ökonomen und Politikern wird er in aller Regel als passe-partout gesehen, der mehr oder weniger verlässlich den sozialen Zusammenhalt stützt. Mein persönliches Anliegen ist es, diejenigen Entwicklungen in den Blick zu nehmen, die von der fortschreitenden Individualisierung von Frauen und Männern angestoßen werden.
* Marianne A. Ferber et al., Beyond Economic Man, Feminist Theory and Economics, The University of Chicago Press, 1993