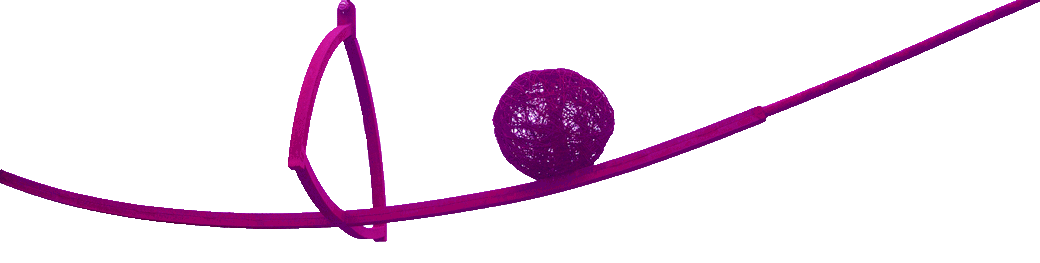2016: Diese Wirtschaft hat dazu beigetragen, Ungleichheiten abzubauen, auch die zwischen Mann und Frau. Doch die vierte industrielle Revolution verändert noch einmal alles: Läuft alles so, wie Wirtschaftslenker und Politiker es heute entwerfen, bleibt die Hoffnung auf reale Gleichheit utopisch, da sich die Haltung zur Rolle der Frau nicht ändert.
In männerdominierten Gesellschaften – das heißt, überall auf diesem Planeten – haben Frauen es immer schon schwer gehabt, den Schatten der Familie zu verlassen und als eigenständige Individuen ins Licht zu treten. Auch in Wirtschaftstheorien waren sie bestenfalls mitgemeint, wurden meist stillschweigend übergangen. Um zu verhindern, dass sie immer wieder aufs Neue aus dem Blickfeld verschwinden, fragt die noch junge Disziplin der feministischen Ökonomie die gegenwärtige Wirtschaftsweise, was ihre Grundlagen sind. Wo ist der Weg, der gleiche Lebenschancen für alle bereithält, für Mann und Frau? In der jüngeren Vergangenheit ist beispielsweise soziale Ungleichheit größer geworden, statt abzunehmen.
Wenn wir die langen ökonomischen Entwicklungstrends nachvollziehen wollen, müssen wir die Anfänge in den Blick nehmen. Auf dem Fundament, das im 18. und 19. Jahrhundert gelegt wurde, wuchs die Effizienz von Produktionsprozessen zum Mantra europäischer Gesellschaften heran. In wenig mehr als zwei Jahrhunderten mutierte die natur- und haushaltsnahe Wirtschaftsweise der Vormoderne zur maßlosen Maschine, die Gegenstände produziert. An die Stelle von Arbeitsformen, die sozial verankert, lebens- und versorgungsnahe sind, trat die technische Produktion von Wohlstandsgütern, die weltweit gehandelt und verkauft werden
Es war der Begriff der produktiven Arbeit, der den Gründervätern industriellen Wirtschaftens den Steigbügel hielt. Sie empfahlen Arbeitsteilung und Technik, um den Output der damals gängigen handwerklichen Fertigung enorm zu steigern. Dabei ging es nicht in erster Linie um die Teilhabe der Vielen oder gar um die Linderung der Nöte der Armen. Vorrangiges Ziel der Überlegungen von Adam Smith und seinen Gefolgsleuten war es, den »Wohlstand der Nationen« im Wettbewerb europäischer Nationalstaaten um Märkte und Ressourcen zu sichern und zu mehren. Regie führte die Rationalität des Homo oeconomicus, die laut dem Befund (nicht nur) feministischer DenkerInnen auch das Handeln des ökonomischen Mannes der Gegenwart anleitet.
Es ist an der Zeit, eine Ökonomie zu forcieren, die nicht steigende Arbeitsproduktivität und Wachstum der Güterproduktion im Sinn hat.
Die exponentielle Steigerung der Arbeitsproduktivität sollte nach den Vorstellungen von Adam Smith und anderen nicht nur den Güterproduzenten, sondern auch denen zugutekommen, die alimentiert werden mussten, weil und obwohl sie nichts herstellten. Künstler, Rechtsanwälte, Geistliche wurden gebraucht, wenngleich ihre Arbeit im engen wirtschaftlichen Sinn unproduktiv war und Ressourcen verschlang, die woanders ertragreicher gewesen wären.
Im ökonomischen Schatten des Mannes
Auf den ersten Blick bleibt verborgen, weshalb in allen ökonomischen Theorien die Arbeit von Frauen gänzlich unerwähnt blieb. Erst der zweite Blick lässt erkennen: Frauen standen lange ausschließlich als familienangehörig im Schatten eines Mannes. Dieser repräsentierte – durchaus als Individuum, jedoch immer als Oberhaupt der Seinen – auch die Arbeit, die im Haushaltsinneren (ausschließlich von Frauen) geleistet wurde. Selten verwies ein kritischer Denker, wie beispielsweise John Kenneth Galbraith, einer der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, auf die entscheidende Schwachstelle des ökonomischen Denkens: dass zwischen den wirtschaftlichen Rollen der Männer und Frauen viel zu wenig unterschieden wurde. Dass der Mann auch noch den privaten Haushalt nach außen repräsentierte, obwohl er zu dessen Wirtschaftsleistung wenig beigetragen hatte, blieb ohne wirksame Kritik.
Nach wie vor ist der Ernährerhaushalt – das Modell: Ein Mann ernährt mit seiner Erwerbsarbeit, die nur ein Teil von Arbeit ist, seine Familie – Grundbaustein ökonomischer Theorien und die Grundlage, auf der Wohlstand und Wohlergehen im globalen Markt errechnet werden. Und die Zeiten sind unwiederbringlich vorbei, in denen ein Familienlohn für Männer als normative Grundlage und familiäres Erwerbsmuster zur Debatte stand. Neu ist: Mann und Frau müssen heute ökonomisch eigenständig sein; das ist unumkehrbar Ziel der Strategien nationaler und internationaler Arbeits- und Wohlfahrtspolitik. Feministinnen kritisieren vor allem das Konzept des privaten Haushalts: Ist er Pendant und Abbild einer Arbeits- und Wirtschaftsweise, die sich rückhaltlos der Wohlstandsproduktion verschrieben hat? Oder ist er etwas (grundsätzlich) anderes? Im Kielwasser von Beschleunigung und Wirtschaftswachstum wird von der kleinsten Wirtschaftseinheit erwartet, ihr ganzes humanes Potenzial in den Erwerb von Einkommen zu investieren.
Andere Arbeitszeiten und freie Sicht auf Haushalt und Familie.
Zeit und Geld für personenbezogene Dienstleistungen, also für Fürsorge, Erziehung und Pflege – heute Care genannt – sind nicht einkalkuliert. Schärfer noch: Sie stehen im Verdacht der Verschwendung. Diese Herangehensweise begeht den großen Fehler, das Leben einer Gruppe von mehreren GutverdienerInnen, die gemeinsam wirtschaften, mit der Lebenslage von Alleinstehenden oder Einelternfamilien gleichzusetzen. Wer für Kinder aufkommen muss, wer Erwachsene zu versorgen hat, die nicht erwerbstätig sind, dessen verfügbares Einkommen wird nicht nur wesentlich geschmälert, der trägt trotz seiner großen »wirtschaftlichen« Leistungen nichts zur nationalen Wirtschaftsleistung bei – weil seine Care-Arbeit statistisch eben nirgends erfasst wird.
Die Zeit ist gekommen, dem Format einer Ökonomie Vorrang zu geben, die nicht steigende Arbeitsproduktivität und Wachstum der Güterproduktion im Sinn hat, sondern die Raum lässt für Spontaneität, Gegenseitigkeit und tätige Fürsorge. Manche blicken neidvoll nach Bhutan, in dessen Verfassung das Bruttonationalglück als Staats- und Wirtschaftsziel rangiert. Kann das kleine Land mit weniger als einer Million Einwohnern, am Südhang des Himalaya gelegen und vorwiegend agrarisch strukturiert, der industriellen Welt die Blaupause für eine Neuorientierung liefern? Wohl kaum.
Fürsorgearbeit auf Augenhöhe mit Erwerbsarbeit
Um dem Hamsterrad von Effizienz und Wettbewerb in die Speichen zu greifen, genügt es nicht, an Frieden, Sicherheit und Freude zu denken. Auch vielstimmige Empfehlungen für Suffizienz, also einen möglichst geringen Rohstoff- und Energieverbrauch, und Mäßigung, für grüne Mobilität und gesünderes Essen, sind den Nachweis bisher schuldig geblieben, dass sie die frauenlose Wirtschaftsweise des Homo oeconomicus ablösen können. Wenn feministische ÖkonomInnen das Geschlechterverhältnis in den Fokus rücken, so stellen sie gleichzeitig die zentrale Frage nach einem Arbeitsbegriff, der den Weg bereitet für eine neue Balance von Arbeit und Leben. Das ist ein Begriff von Arbeit, der bezahlte Erwerbsarbeit mit bisher nicht bezahlter Fürsorgearbeit, mit ehrenamtlicher Arbeit und mit kreativen Tätigkeiten in Einklang bringt.
Neues Wirtschaftsmodell einfordern
Auch die Statistik bemüht sich in den vergangenen Jahren, die Messmethoden von Wohlstand und Lebensqualität zu korrigieren. Noch immer unübertroffen in der Reichweite ihrer Analyse ist die sogenannte Stiglitz-Kommission, die 2008 vom damaligen französischen Präsidenten Sarkozy berufen wurde und 2009 ihren Abschlussbericht vorlegte. Das hochrangig besetzte Gremium (unter anderem fünf Nobelpreisträger und die beiden renommierten feministischen Ökonominnen Bina Agrarwal aus Indien und Nancy Folbre aus den USA, jedoch ohne deutsche Beteiligung) empfahl, die Ökonomie auf den privaten Haushalt auszudehnen und zu untersuchen, was dort geleistet wird. Die Kommission verweist nachdrücklich darauf, dass es Wohlstandskriterien zu betrachten gilt, die nicht allein durch Einkommen ausgedrückt werden, wie materieller Lebensstandard, Gesundheit, Bildung, persönliche Tätigkeiten, politische Stimme und Governance, soziale Beziehungen und andere, die in Wirtschaftstheorien keine Berücksichtigung finden.
Ist dies endlich die Chance, unser Ökonomiemodell vom Kopf auf die Füße zu stellen? Die erwähnte Kommission hält die gängige Verteilung von Familienpflichten für einen Mangel. Er behindere sozialen Fortschritt und ein Wirtschaften, das an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist. Es kann meines Erachtens nicht sein, dass Frauen Dienstleistungen erbringen, aus denen wachstumsbesessene Volkswirtschaften ihren Vorteil ziehen. Dass es zwischen Frauen und Männern auf den Arbeitsmärkten eine tiefe Ungleichheit gibt, das ist nur eine der Konsequenzen der Tatsache, dass die heute herrschende Ökonomie aus den Zusammenhängen lebendigen Lebens entbettet ist. Leider finden die Erkenntnisse der Stiglitz-Kommission bisher wenig Widerhall im wissenschaftlichen Diskurs, da dieser weiterhin vom Standpunkt der Produktionstheorien geführt wird.
Gängige Rollenverteilung behindert sozialen Fortschritt und Wirtschaften, das an Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist.
Das heraufziehende digitale Zeitalter inklusive der sich abzeichnenden kompletten Vernetzung industrieller Produktion wird die Ungleichgewichte der Lebenslagen von Frauen und Männern noch vertiefen, wenn es nicht gelingt, die Kluft zwischen scheinbar »produktiver« bezahlter (meist industrienaher) Erwerbsarbeit und Fürsorgearbeit, zwischen Arbeits- und Lebenswelt zu verringern. Arbeitszeitmodelle, welche die Bedürfnisse des Familienlebens berücksichtigen, wie sie derzeit auch in den Gewerkschaften diskutiert werden, (dazu gehören ElterngeldPlus und Familiengeld), sind ein erster Schritt. Er muss begleitet werden von einer freien Sicht auf Haushalt und Familie, die es erlaubt, der eindimensionalen Ökonomisierung des Alltags mit allem Nachdruck die Stirn zu bieten.
Dieser Beitrag ist in OXI 12/2016 erschienen.
Veröffentlicht auf oxiblog.de